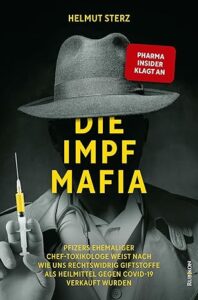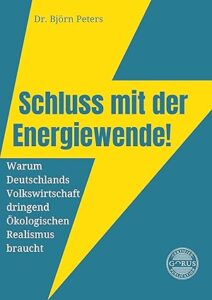Anstelle eines Vorworts verweist der Autor auf eine Reihe klassischer Narrative, die einen nahen Untergang beschwören. Peters will sein Buch als einen Aufruf zu einem ökologischen Realismus verstanden wissen, der gemeinsam mit einer ökologisch-technologisch fortschrittlichen Stratege das Ziel eines planetarischen Wohlstands vor Augen hat.
Die damit in Zusammenhang stehende Umweltdebatte sieht der Autor gefangen in Aussagen über die Klimaentwicklung, in der er ein Unterthema ausmacht.
Als Energieökonom ist ihm dabei der eigene, naturwissenschaftliche Hintergrund hilfreich, wobei er in seinen Analysen zu interessanten Ergebnissen gelangt. Dies vor allem unter dem Blickwinkel des Umstieges von Kohle und Atomstrom auf „wetterabhängige“ Energie.
Peters kritisiert das häufige Fehlen energieökonomischer Analysen als Voraussetzung gelingender Veränderungen und er warnt vor einem weiteren Abwandern deutscher Industrieunternehmen.
Es geht ihm zunächst um die Strategie, die hinter der Energiewende steckt und er hinterfragt die technischen und gesetzlichen Voraussetzungen ihres Entstehens.
Da die Politik den in Gang gesetzten Energieumbau mit großen Vorteilen für alle Verbraucher beworben habe, geht Peters diesem Versprechen nach und hinterfragt die Diskrepanz zwischen Zielvorstellung und Wirklichkeit.
Dabei werde als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Zielvorstellungen gemeinsam zu erreichen sind und dies ohne die Erwägung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Verbraucherfreundlichkeit.
Es gelte das Ziel einer Elektrifizierung aller volkswirtschaftlichen Bereiche.
Die Staatsausgaben für importierte Energierohstoffe sollten nach dieser Umstellung wegfallen und durch heimische Wirtschaftskraft ersetzt werden.
Dabei sollten die Bürger als Investoren der Energiewende beteiligt werden. Mit Ausnahme der Kostendegression bei Solarstrom sei allerdings bisher kein Ziel der Energiewende erreicht worden.
Ganz im Gegenteil habe eine volkswirtschaftliche Verschwendung großen Ausmaßes stattgefunden.
Björn Peters unterstellt der Energiewende einen grundsätzlichen Dankfehler, der mit der Vorstellung einer unendlichen Verfügbarkeit von Wind und Sonne einerseits, der erzielbaren Energiemenge, sowie einer zeitlich-räumlichen Verteilung (von Energie) andererseits einhergehe.
So müsste z.B. ein Zehntel der Gesamtfläche Deutschlands mit Solarpaneels zugestellt werden, um das Land komplett mit Solarenergie zu versorgen.
Dass eine Selbstversorgung mit Wind und Sonne nicht möglich sei, habe man aber bereits vor dreißig Jahren errechnen können.
Peters spricht von einem Lobbyismus in wissenschaftlicher Verkleidung, der bestrebt ist, Voraussetzungen zu schaffen, die sich am Markt durchsetzen. Es entstehe eine „es werde schon klappen“ Mentalität.
Schluss mit der Energiewende! Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht
von Dr. Björn Peters
25,- €
Eine wetterabhängige Energieversorgung sei auf sehr große, hierfür nutzbare Flächen angewiesen, über die Europa nicht verfüge. Im Falle von Dunkelflauten müsse die Energie aus großen Entfernungen zu den Verbrauchern transportiert werden, was das Gegenteil der geforderten Dezentralität bedeute. Allerdings seien auch die erwartbaren Kosten für einen Transport von Gas, Wasserstoff, Methan oder Methanol quer durch Europa im dreistelligen Milliardenbereich angesiedelt.
Auch Batteriespeicher seien keine zielführende Lösung, weil Batterien auf der Basis von Lithium und Kobalt eine technische Sackgasse seien. Zudem können sie nur kurzfristige Schwankungen korrigieren. Speicher seien die falsche Antwort auf die richtige Frage und damit hat der Autor auch Gaskraftwerke mit einer Leistung von 80-100 GW im Blick und gibt zu bedenken, dass der Staat, aufgrund von Mangel an Investoren, am Ende zahlreiche große Gaskraftwerke bauen müsste, was ihn überfordere. Auch eine Koppelung unterschiedlicher elektrischer Sektoren sei auf eine bestimmte Durchschnittsleistung aus Solar und Windkraft angewiesen, so dass ein Vielfaches an Anlagen errichtet werden müsse.
Das Aufheizen von Wärmespeichern könnte eine Lösung sein. Ausreichend groß könnten sie tagelang Heizenergie liefern. Peters empfiehlt auch das Erzeugen von Methan, das besser als Wasserstoff gelagert und transportiert werden könne. An diesem „Power to Gas-System werde aktuell geforscht.
Unter Berücksichtigung des gesamten Energieaufwandes sinke der Wirkungsgrat allerdings auf 60%.
Die Einsatzmöglichkeiten von Methan seien allerdings zugleich sehr vielseitig.
Eine Anpassung des Stromverbrauches an eine temporäre Verfügbarkeit hält der Autor für schwer vermittelbar. Ein solches Nachfragemanagement würde sowohl eine Produktions- als auch eine Urlaubsplanung der Arbeitnehmer verunmöglichen. Auch während der Schulferien und an den Weihnachtsfeiertagen müssten die Produktionsprozesse aufrechterhalten werden und Peters beklagt, dass das von den Gewerkschaften nicht erkannt werde.
Kritisch sieht er auch eine im Rahmen der Energiewende angewandte Überwachung. Er sieht hier Repression auf dem Vormarsch.
Die in ihrer vorfindlichen Form sichtbare Energiewende bleibe Stückwerk, weil sie schlicht nicht umzusetzen sei. Die erforderliche Energiedichte und wetterbedingte Schwankungen seien wesentliche Parameter. Das zwinge zugleich auch zu dauerhaften Subventionen.
Peters spricht an dieser Stelle von einer notwendigen „Veredelung“ bei Wind und Solarenergie, um sie individuell einsetzen zu können. Eigentlich sei aber der Materialverbrauch viel zu hoch. Es entstehe ein zu geringer „Erntefaktor“.
Hinzu komme eine physikalische Begrenztheit im Zusammenhang mit den Einspeisungsschwankungen. An den Universitäten habe sich bislang leider noch keine „Statistische Meteorologie“ als Lehrfach etabliert.
So schwanke z.B. die Windstromeinspeisung teilweise um mehr als die Hälfte. Zudem sei es nicht so, dass Windkraftanlagen keine zusätzliche Energie etwa zur Rotorsteuerung und zur Beheizung der Rotorblätter benötigen.
Wenn alle 20000 Windkraftanlagen in Deutschland still stehen, benötigen sie zugleich so viel Strom wie ein Großkraftwerk, weshalb eine „gesicherte“ Leistung nicht gegeben sei. Der Strom müsse zur Verfügung stehen, wenn man ihn auch benötige.
Im Winter sei der zeitliche Sonnenanteil viel zu gering. Der statistische Effekt zum Erreichen eines energiewirtschaftlichen Mehrwertes werde nicht erreicht.
Anhand der seit 2015 stark gestiegenen Netzeingriffe sei abzulesen, dass die Schwankungen nicht mehr (natürlich) ausgeglichen werden können.
Dabei seien die thermischen Kraftwerke nicht unbegrenzt flexibel, um Schwankungen auf Dauer auszugleichen, weil sie im Teillastbereich unrentabel laufen. Die zusätzlich anfallenden Kosten zahlen die Steuerzahler.
Europa sei flächenmäßig einfach zu klein, um eine sichere Versorgung mit Sonne und Wind zu garantieren und zu finanzieren. Es stelle sich die Frage, wie groß ein Land sein müsse, damit das gelingen kann.
Flächendeckende Wind- und Solarparks mit gewaltigen Stromleitungen in einer Länge von hunderttausenden von Kilometern, seien aber auch militärisch nicht zu schützen.
Stromspeicher seien maximal für einige Tage ausgelegt und aufgrund ihrer hohen Verluste hinsichtlich ihrer ökonomischen Bilanz problematisch.
Bei allem müsse bedacht werden, dass das Ziel der Energiewende schließlich eine Vollversorgung des ganzen Landes durch Sonne und Wind vorsehe und dies bei jeder Wetterlage.
Mit letzterer hat sich der Autor umfänglich wissenschaftlich auseinandergesetzt und gelangt zu dem Ergebnis, dass Wind und Sonne nicht integrierbar sind. Der darum herum entwickelte Aufwand werde den Strom dauerhaft doppelt so teuer machen wie in anderen vergleichbaren Ländern. Es sei fatal, dass man in Deutschland Kern- und Kohlekraftwerke gleichzeitig abgeschaltet habe und neue Gaskraftwerke viel zu langsam baue, um schnell genug Ersatz zu schaffen.
Peters spricht von einem großen Dilemma und einem politischen Scherbenhaufen, dessen volkswirtschaftliche Folgen noch nicht abzusehen seien.
Durch das EEG sei ein ganzer Stromsektor entstanden, der über staatliche Umlagen finanziert werde. Zugleich hatten thermische Kraftwerke einen zu geringen Gewinn erwirtschaftet und durch größeren Regelbedarf hohen Verschleiß erzeugt.
Der weitere Ausbau der „Wetterabhängigen“ bei gleichzeitiger Abschaltung gesicherter Leistung habe das Verhältnis von regulierbarer zu wetterabhängiger Stromproduktion verschoben.
Damit sei Deutschland das einzige Land der Welt, das etwas Funktionsfähiges abbaue, bevor Neues aufgebaut ist. Es handele sich hier um ein „Großexperiment“.
Den Ausstieg weiter fortzusetzen sei politischer Vandalismus, so der Autor.
Das ist eine mutige Aussage, die auf den sozialen Sprengstoff verweist, der ganz offensichtlich verdrängt wird.
Bei Zugrundelegung der Kostenpositionen (EEG Umlage/Netzentgelte/Energiesteuer) betrage die jährliche Belastung der Bürger 120 Mrd. Euro. Eine Teuerung, die vor allem die sozial schwächeren trifft. Zugleich führe diese Teuerung natürlich auch zur Verteuerung nahezu aller Produkte.
Die dadurch der Wirtschaft entzogenen Mittel fehlen an anderer Stelle und der Autor geht so weit zu sagen, dass die deutsche Wirtschaft die Energiewende nicht überleben wird.
Dass der Mix aus zu hohen Kosten und mangelnder Versorgungssicherheit im Umfeld der Industrieverbände keinen größeren Protest auslöst, liege an seiner raffinierten Konstruktion, die den Glauben verbreite, dass es kein Zurück mehr gebe.
Zwar können sich Betriebe, die mehr als 16% ihrer Produktionskosten für Strom aufwenden, von der EEG-Umlage befreien lassen, aber alle anderen Betriebe erleiden erhebliche Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu ausländischen Unternehmen.
Alle Prämissen der Energiepolitik und vieler anderer Politikfelder müssten – so Peters – auf den Prüfstand.
Der Autor plädiert für einen ökologischen Realismus und beklagt, dass eine Debatte hierzu von problematischen Narrativen verstellt sei. Es gebe eine ganze Flut von Ideologismen, die jedoch nicht belastbar seien.
Das betreffe die Kerntechnik, sowie die Knappheits- und die Ressourcen-Debatte generell.
Hier fordert der Autor eine dezidierte Sicht auf den Ressourcenpool und den Nutzungsbedarf entsprechend einem wirtschaftlichen Zeithorizont, den es zu berücksichtigen gilt.
Es gelte, technische Innovationen zu verstehen, um sich vor vermeintlicher Rohstoffknappheit nicht zu fürchten.
Interessant ist auch Peters Blick auf die Landnutzung durch den Menschen, die während der Steinzeit viel höher gewesen sei. Hier meint er jedoch nicht das Zubetonieren und das Asphaltieren großer Flächen, sondern die landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Technik könne und solle helfen in einem besseren Einklang mit der Natur zu leben und der Autor widmet einer umfänglichen Betrachtung der Kerntechnik gleich einige Kapitel. Dabei gelangt er unter Einbezug aller bekannten Probleme und Parameter zu einer insgesamt positiven Einschätzung ihres Potenzials, das auf jeden Fall genutzt werden müsse.
Das Szenario einer scheiternden Energiewende, das der Autor aufzeigt, macht deutlich, dass eine Industrienation, die sich selbst ernst nimmt, nicht sehr viele andere Alternativen verbleiben.
Es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass sich die amtierende Bundesregierung mit einer Rückholbarkeit der noch verbliebenen Kernkraftwerke beschäftigen wird. Hier sei letztendlich allein der politische Wille entscheidend. Eine Volkswirtschaft müsse imstande sein, die von ihr benötigte Energie zuverlässig, kostengünstig, umweltfreundlich und wenn möglich auch nachhaltig zu generieren.
Es gebe eine ganze Reihe von Unternehmen, die aktuell an der Weiterentwicklung der Kerntechnik arbeiten. Hinsichtlich der Fusionstechnik glaubt der Autor nicht an deren Verwirklichung noch in diesem Jahrhundert.
Bei allem gelte es auch, die Bedrohung der Artenvielfalt auf der Erde ernst zu nehmen. Es bedürfe umfassender Gesamtkonzepte, so dass ein Ausgleich zwischen Bebauen und Bewahren möglich werde. Dabei müssen die angewandten Techniken kompakt, kostengünstig und kreislaufwirtschaftlich angelegt sein. Standardisierung und Simplifizierung seien zu berücksichtigen.
Grundsätzlich geht er davon aus, dass der vorhandene Wissenspool groß genug ist, um ökologisch unbedenkliche Verfahren auch ganz grundsätzlich im Bereich der Rohstoffgewinnung auf den Weg zu bringen. Moderne Technologie müsse aber auch politisch auf den Weg gebracht werden.
Peters fordert die Bereitschaft, Dogmen zu hinterfragen, um Fehler zu korrigieren.
Dabei kritisiert er die politisch gewollte Verteuerung der Energie zugunsten von wetterabhängiger Energie als strategischen Fehler und empfiehlt ein strukturiertes Kostensenkungsprogramm bei gleichzeitiger Ausweitung des Angebotes.
Als suizidal bezeichnet er das deutsche „Null-Emissions-Streben“ mit der Zielmarke 2045.
Vor dem Hintergrund des Verlustes wertvoller Industrieproduktion müsse die Energiepolitik neu aufgestellt werden. Kurz- und mittelfristige Maßnahmen seien anzustoßen, wofür er eine ganze Reihe von Beispielen aufzählt.
Peters plädiert offen für eine Beendigung der aus seiner Sicht schädlichen Klimapolitik und ihren Ersatz durch wirksamere Maßnahmen.
Auch ein Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen könne diskutiert werden.
Innerhalb der EU habe die Bundesregierung die Aufgabe, ihr großes Gewicht in Brüssel einzubringen, um damit wenig wirksame Direktiven aufzuheben.
Auch innerhalb des Bildungssektors plädiert er für die Vermittlung einer realistischen Betrachtung von Problemfeldern, unter Zuhilfenahme ernst zu nehmender, also empirisch belastbarer Fakten.
Hier habe es leider eine ganze Reihe bedenklicher Entwicklungen gegeben.
Die Einführung eines Zielprinzips in der Verfassung (Staatsziel) sei ebenso zu wünschen, wie die eines Effizienzprinzips, wobei es zugleich hilfreich wäre, wenn sich der Staat neutral verhielte.
Statt Aktivismus zu entfalten, solle die Politik lieber eine breite Technologieförderung betreiben.
Die Einbahnstraße der Energiewende gelte es zu beenden.
Es stelle sich die Frage, was Deutschland eigentlich davon abhalte, einen vernünftigen Weg einzuschlagen, der Wohlstand für alle verspricht.
Das ist ein sehr lesenswertes Buch, wo einige sonst eher vernachlässigte Sichtweisen berücksichtigt werden. Es ist bei GORUS Publication erschienen. ISBN 978-3-98617-082-0 / Hardcover / 135 Textseiten, sowie Hinweise auf weiterführende Literatur, Danksagung und ein Portrait des Autors.
Zum Weiterlesen: