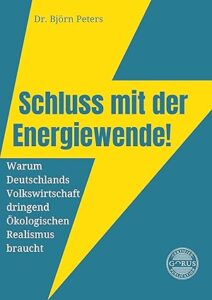Im vergangenen Jahr wurde immer offensichtlicher, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann, dass eine Rückeroberung der russischsprachigen Regionen im Südosten nicht möglich ist – ohne einen dritten Weltkrieg auszulösen. In Washington hat sich diese Erkenntnis offensichtlich durchgesetzt. Was treibt die europäischen Regierungen an, stur am bisherigen Kriegskurs festzuhalten?
Ein wesentliches Hindernis für erfolgreiche Friedensverhandlungen sind natürlich Selenskyj und seine Clique. Nach Kriegsende könnten sie Wahlen kaum mehr verhindern und ihre Bilanz würde nicht gut ausfallen. Im Frühjahr 2022 hätten sie mit dem Verzicht auf einen NATO-Beitritt und auf die Krim sowie Autonomie für Teile der Regionen Donezk und Lugansk ein sofortiges Kriegsende haben können. Sie haben aber damals, offenbar nach britischer Intervention, die Gespräche abgebrochen, um auf einen militärischen Sieg zu setzen.
Aktuell ist ein realistischer Abschluss nur unter Aufgabe von NATO-Mitgliedschaft, Krim und vier weiteren Regionen zu haben. Dazwischen liegen für die Ukraine mehr als drei Jahre Krieg mit hunderttausenden Toten, die für nichts auf die Schlachtbank getrieben wurden. Das können Selenskyj und Co. politisch nicht überleben.
Einmal mit Profis arbeiten oder Ugurs Geständnis: Lektürehilfe zu „Projekt Lightsspeed“
von Hesper-Verlag
25,00 €
Neben dem ukrainischen Regime sind es vor allem die europäische Spitzenpolitiker Macron, Merz und Starmer, die einen baldigen Friedensschluss behindern. Sie basteln an einer „Koalition der Willigen“ und arbeiten an der Intensivierung von Waffenlieferungen. Die drei europäischen Kriegshelden aus der Etappe sind daheim schwer angeschlagen.
Sie sitzen auch bei Verhandlungen um einer Lösung des Ukraine-Konflikts bestenfalls am Katzentisch. Sie haben nicht die Kraft, eine eigene Perspektive in die eine (militärische) oder andere (politische) Richtung durchzusetzen. Sie haben aber gerade noch genug Kraft, um das Regime in Kiew am Leben zu erhalten und einen „Deal“ zwischen den USA und Russland zu sabotieren.
Warum tun sie das? Ein Bericht auf „Amerikanets“ argumentiert mit Eigeninteressen des EU-Establishments. Neue Ukraine-Fonds und Vergabestrukturen hätten eine Bürokratie geschaffen, die davon „lebt“. Außerdem biete der Ukraine-Krieg die Möglichkeit, mit riesigen Rüstungsprogrammen eine künstliche Konjunktur zu schaffen. Die seit 2021 um 50 Prozent gestiegenen Verteidigungsausgaben der EU-Länder seien auch ein ökonomisches Stützungsinstrument für die niedergehende Wirtschaft. (https://www.amerikanets.com/p/why-is-europe-all-in-on-ukraine)
Ebenfalls eine Erklärung liefert Ian Proud in einer Analyse für die „Strategic Culture Foundation“ (https://strategic-culture.su/news/2025/10/21/european-leaders-continue-to-be-in-denial-on-ukraine-but-will-nevertheless-carry-on-with-their-failed-strategy/). Der Autor war von 1999 bis 2023 Mitglied des Diplomatischen Dienstes Großbritanniens. Von 2014 bis 2019 diente er an der britischen Botschaft in Moskau. Außerdem war er Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorsitzender der Anglo-Amerikanischen Schule in Moskau. Wir haben seine Analyse übersetzt.
Beginn der Übersetzung:
Ukraine: Europäische Regierungschefs verleugnen die Realität und setzen ihre gescheiterte Strategie fort
In einem Dilemma gefangen, leugnen die europäischen Staats- und Regierungschefs weiterhin die offensichtliche Realität der verheerenden Lage in der Ukraine, die sich mit der Zeit nur noch verschlimmern wird.
Dennoch sehe ich keinerlei Bereitschaft zum Kurswechsel, trotz des offensichtlichen politischen Risikos und der zunehmend düsteren Prognosen für Europa und die Ukraine, sollten sie diesen aussichtslosen Krieg weiter vorantreiben. Der Krieg in der Ukraine hängt nun vollständig von der Zahlungsfähigkeit der europäischen Staaten ab. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr, basierend auf dem jüngsten Haushaltsplan der Ukraine für das Fiskaljahr 2026.
Die Ukraine selbst ist bankrott und hat keinen Zugang zu anderen externen Kapitalquellen, abgesehen von den Mitteln der Regierungen, die den andauernden Krieg unterstützen. Damit rückt die Enteignung von 140 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die derzeit in Belgien eingefroren sind und die die Kommission für einen Wiederaufbaukredit verwenden möchte, wieder in den Fokus.
Der Begriff „Wiederaufbaukredit“ ist irreführend, da die enteigneten russischen Vermögenswerte nicht dem Wiederaufbau, sondern der Finanzierung des ukrainischen Kriegseinsatzes dienen würden. Bundeskanzler Merz deutete kürzlich sogar an, dass der Fonds der Ukraine ermöglichen könnte, den Kampf um weitere drei Jahre fortzusetzen. Das wahrscheinlichste Szenario für den schrecklichen Fall, dass der Krieg in der Ukraine tatsächlich weitere drei Jahre andauern sollte, ist, dass die russischen Streitkräfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die gesamte Donbass-Region – bestehend aus den Gebieten Donezk und Luhansk – einnehmen würden.
Dieser Rückzug der Ukraine aus dem Donbass scheint neben einer ukrainischen Neutralitätserklärung und dem Verzicht auf jegliche NATO-Beitrittsambitionen die Grundlage für Präsident Putins Bedingungen für ein sofortiges Kriegsende zu sein. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die russischen Streitkräfte weitere Gebiete in den Oblasten Saporischschja und Cherson sowie in Dnipropetrowsk, wo sie in letzter Zeit vorgerückt sind, erobern werden.
Angesichts des derzeit schleppenden Kriegsverlaufs, in dem Russland wöchentlich kleinere Gebiete annektiert, ist es daher sehr wahrscheinlich, dass die Ukraine in drei Jahren einen Frieden eingehen muss, der für sie noch ungünstiger ist als der jetzige. Sie wird dann weiteres Land verloren haben und möglicherweise Hunderttausende Soldaten sind gefallen oder verwundet worden.
Schluss mit der Energiewende! Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht
von Dr. Björn Peters
25,- €
Eigentlich sollten europäische Entscheidungsträger fähig sein diese düstere Lage klar zu erkennen und Selenskyj dazu bewegen, sich jetzt für Frieden zu entscheiden. Die europäische Politik wird jedoch von zwei zentralen Überlegungen bestimmt. Erstens von der emotionalen Überzeugung, dass ein langwieriger Krieg Russland so sehr schwächen könnte, dass Präsident Putin gezwungen wäre, sich mit ungünstigen Bedingungen zufriedenzugeben. Die Idee einer strategischen Niederlage Russlands – die von europäischen Politikern häufig geäußert wird – hält einer ernsthaften Prüfung jedoch nicht stand.
Russland steht nicht vor denselben erheblichen sozialen und finanziellen Herausforderungen wie die Ukraine. Seine Bevölkerung ist wesentlich größer, und eine breitere Einberufung von Männern war bisher nicht nötig – Russland kann genügend neue Soldaten rekrutieren und hat seine Armee seit 2022 sogar verstärkt. Die Ukraine greift weiterhin auf die Zwangsmobilisierung von Männern über 25 Jahren zurück und wendet dabei oft extreme Methoden an, bei denen junge Männer gegen ihren Willen von der Straße geholt und an die Front geschickt werden.
Entscheidend ist, dass Russland den Krieg im derzeitigen langsamen Tempo wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum fortsetzen könnte, ohne auf eine breitere Mobilisierung junger Männer zurückgreifen zu müssen, was sich innenpolitisch für Präsident Putin als unpopulär erweisen könnte. Je länger der Krieg jedoch andauert, desto stärker wird der Druck auf die Ukraine, auch von westlichen Verbündeten, zunehmen, die Mobilisierung zu intensivieren und junge Männer unter 25 Jahren gefangen zu nehmen, um die stark dezimierten Streitkräfte an der Front zu verstärken.
Bislang gab es in der Ukraine erheblichen Widerstand dagegen. Die Mobilisierung junger Männer ab 22 Jahren wäre für Präsident Selenskyj unpopulär und würde die ohnehin schon katastrophale demografische Lage der Ukraine weiter verschärfen: 40 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sind bereits verloren gegangen, entweder durch Migration oder durch Tod an der Front, und diese Zahl wird mit der Dauer des Krieges weiter sinken.
Russlands Finanzlage ist deutlich besser als die der Ukraine. Russland hat eine sehr niedrige Verschuldung von rund 15 % des BIP und weist trotz eines voraussichtlichen Rückgangs im zweiten Quartal 2025 einen gesunden Leistungsbilanzüberschuss auf. Selbst wenn Europa Russlands eingefrorene Vermögenswerte beschlagnahmen sollte, verfügt das Land weiterhin über beträchtliche und wachsende Devisenreserven, die kürzlich erstmals die Marke von 700 Milliarden US-Dollar überschritten haben.
Russlands militärisch-industrieller Komplex übertrifft westliche Lieferanten weiterhin in der Produktion von Militärausrüstung und Munition. Selbst im derzeit unwahrscheinlichen Fall, dass Russlands Handelsbilanz negativ ausfällt – was westliche Kommentatoren als Zerstörung der russischen Kriegswirtschaft bezeichnen –, hätte das Land aufgrund seiner engen Verbindungen zu den Entwicklungsländern, die durch die BRICS-Staaten noch verstärkt wurden, weiterhin erhebliche Möglichkeiten, Kredite von nicht-westlichen Kreditgebern aufzunehmen.
Die Ukraine ist faktisch bankrott, da sie aufgrund ihrer Entscheidung, alle Schuldenzahlungen auszusetzen, keine Kredite auf den westlichen Kapitalmärkten aufnehmen kann. Da die Verschuldung bis 2025 voraussichtlich 110 % erreichen wird, selbst ohne Berücksichtigung von Krediten, die durch eingefrorene russische Vermögenswerte besichert sind, ist sie vollständig auf westliche Hilfen angewiesen. Die ukrainische Handelsbilanz hat sich während des Krieges kontinuierlich verschlechtert, was ihre Abhängigkeit von Kapitalspritzen aus dem Westen verstärkt, um ihre Devisenreserven im Plus zu halten.
Während die Entschlossenheit der Ukraine zu kämpfen unbestreitbar ist, ist der Glaube im Westen, dies werde die enormen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen eines langwierigen Abnutzungskrieges gegen Russland bewältigen, völlig unbegründet. Betrachten wir also die rationale Erklärung für Europas anhaltende Bereitschaft, den Krieg in der Ukraine zu verlängern.
Die unbequeme Wahrheit ist, dass sich Europas politische Führung selbst in diese Lage gebracht hat, weil sie fest entschlossen ist, Russlands Forderungen in Friedensverhandlungen nicht nachzugeben. Tatsächlich besteht eine unnachgiebige und unerschütterliche Ablehnung jeglicher Gespräche mit Russland, die seit 2014 immer stärker geworden ist. In weiten Teilen Europas wendet sich das politische Blatt jedoch gegen das kriegsbefürwortende Establishment.
Nationalistische, kriegsgegnerische Parteien gewinnen in Mitteleuropa, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und sogar in Polen an Boden. Und trotz der positiven Annäherungsversuche von Präsident Trump an Verhandlungen mit Präsident Putin bremst die Trumpophobie die europäische politische Führung zusätzlich in ihrem Bestreben, ihre Position zu ändern. Ein Kurswechsel hin zu direkten Verhandlungen mit Russland hätte also potenziell katastrophale politische Folgen für die europäischen Staats- und Regierungschefs, deren sie sich sicherlich bewusst sein müssen.
Eine vollständige Kehrtwende in der europäischen Diplomatie würde die Erkenntnis voraussetzen, dass der Krieg gegen Russland nicht zu gewinnen ist und dass Russlands eigentliche Anliegen – namentlich die Neutralität der Ukraine – endlich als politische Realität anerkannt werden müssten. Auf dieser Grundlage stünden europäische Politiker vor der Herausforderung, ihren zunehmend skeptischen Wählern zu erklären, dass ihre Strategie zur Niederlage Russlands gescheitert ist, nachdem sie vier Jahre lang stets von deren Erfolg gesprochen hatten.
Dies könnte potenziell zum Sturz internationalistischer Regierungen in ganz Europa führen, beginnend in zwei Jahren mit den Neuwahlen in Polen und Frankreich und 2029 mit den Wahlen in Großbritannien und Deutschland. Es gibt aber auch tiefer liegende Probleme.
Ein Kriegsende würde den Beitrittsprozess der Ukraine zur Europäischen Union beschleunigen, mit potenziell verheerenden Folgen für die gesamte Finanzbasis Europas. Die Europäische Kommission steht vor der Wahl, ein Europa der zwei Klassen zu akzeptieren und die Ukraine ohne die finanziellen Vorteile der bestehenden Mitgliedstaaten aufzunehmen. Verständlicherweise würde dies in der Ukraine selbst, die so viel Blut für die europäische Integration geopfert hat, weit verbreiteten Unmut hervorrufen und in einem unzufriedenen Land mit einer Armee von fast einer Million Menschen zu massiven internen Unruhen und möglicherweise sogar zu einem Konflikt führen.
Alternativ müsste die Europäische Kommission ihren Haushalt umstrukturieren und würde dabei auf erheblichen Widerstand der bestehenden Mitgliedstaaten stoßen, die dadurch jährlich Milliarden Euro an Subventionen an die Ukraine verlieren würden. Hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine strategische Niederlage Russlands, die jeder rationale Beobachter für unwahrscheinlich hält, und der Akzeptanz des Scheiterns ihrer Politik, das einen weitreichenden Machtverlust und massive wirtschaftliche und politische Turbulenzen zur Folge hätte, entscheiden sich Europas Staats- und Regierungschefs für Ruhe und machen weiter wie bisher.
Wenn sie klug wären, würden Politiker wie Ursula von der Leyen, Merz, Starmer oder Macron ihre Strategie ändern und versuchen, ihr Scheitern zu erklären, bevor der politische Wandel in Europa sie alle von der Macht verdrängt. Doch ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie das nötige politische Geschick dafür besitzen. Daher werden wir weiterhin abwarten, während sich die Gewitterwolken über Europa immer weiter verdunkeln.
Zum Weiterlesen: